Es ist nahezu unmöglich, sich dem Hype um das Thema Künstliche Intelligenz (KI) zu entziehen. Insbesondere das Aufkommen der generativen KI, von Instrumenten wie ChatGPT oder Midjourney und der zugrundeliegenden großen Sprachmodelle, hat die Spielregeln für das Marketing neu definiert. Auch in der Mediaplanung, bei der Entwicklung und Umsetzung von Werbestrategien, entstehen neue Handlungsfelder, Chancen und Herausforderungen.
Während generative KI nicht zuletzt geeignet ist, die Erstellung von Werbemitteln, von Texten und Bildern, zu vereinfachen, sind für den ersten, vorgelagerten Schritt einer professionellen Mediaplanung zunächst vor allem analytische Kompetenzen gefragt. Klassischerweise werden dafür bestehende Auswertungen wie die Audience-Analysis von Nielsen oder Markt-Media-Studien wie die Allensbacher Markt- und Werbeträgeranalyse durchforstet. KI kann dabei helfen, diese Informationen schnell für spezifische Zwecke aufzubereiten und um weitere Daten zu Marktentwicklungen oder Erkenntnisse aus dem Social Web anzureichern. Dabei ist durchaus Augenmaß und kritische Vorsicht angebracht. Denn selbst wenn in ChatGPT & Co mittlerweile auch Quellen angegeben werden, sind diese Werkzeuge eben keine Suchmaschinen. Der Prozess der Inhaltegenerierung ist aktuell immer noch von der Quellenerzeugung abgekoppelt, d.h. es werden erst nachträglich passende Quellen zum erstellten Content angeführt. Und auch wenn die Systeme mittlerweile deutlich besser geworden sind, besteht immer noch die latente Gefahr des Halluzinierens, wenn der KI keine belastbaren Informationen zu einer Anfrage vorliegen. Demgegenüber ermöglicht die sogenannte Retrieval Augmentation Generation (RAG), die inhaltliche Anreicherung der trainierten Basis der Sprachmodelle mit Daten aus zusätzlichen Quellen. Dies erfolgt entweder über ein gezieltes „Anzapfen“ der entsprechenden Datenbank oder im einfachsten Fall über den Dateiupload, direkt im Nutzer-Interface der KI.
Auf diese Weise schafft man die Voraussetzungen, um verschiedene Szenarien analysieren und durchspielen zu können. Aus Daten vergangener Kampagnen lassen sich Muster ableiten, Prognosen werden möglich, wie Zielgruppen über verschiedene Touchpoints erreichbar sein dürften. Dadurch eröffnet sich die Möglichkeit der flexiblen Planungsanpassung und -auswertung. Die Auswirkungen von Änderungen der Kanäle oder Budgets lassen sich umgehend simulieren. Die Systeme versetzen damit die menschlichen Akteure in die Lage, schnell und präzise auch hochkomplexe Entscheidungssituationen aufzulösen.
KI und die Ausspielung von Werbemitteln
Neben dieser Effizienzsteigerung im Rahmen des traditionellen Prozesses der Mediaplanung, ermöglicht der Einsatz von KI aber auch Produktivitätsgewinne bei der Werbeausspielung und operativen Umsetzung der Mediaplanung. Schon seit geraumer Zeit lassen sich etwa im Rahmen des Programmatic Advertisings, Werbebotschaften in Echtzeit und personalisiert, vor allem basierend auf Daten aus Nutzer-Profilen ausspielen. KI kann dazu genutzt werden, den Prozess der Werbebuchung und -platzierung zu automatisieren, beispielsweise indem vorab Zielerfolgskennziffern definiert werden, die der KI vorgegeben werden. Anschließend füttert man das System mit Informationen zu möglichen Platzierungsoptionen, verfügbaren Kanälen und Werbeformaten sowie den Einschränkungen zur Laufzeit und Budgetierung der Kampagne. Auf dieser Grundlage lernt das System dann mittels „Trial & Error“ eigenständig die optimalen Entscheidungen zu treffen. Es legt fest, welche Formate in welchen Medien zu welchen Zeiten belegt werden sollten und wie das Budget somit ergebnisorientiert zu investieren sind. Dazu wird mathematisch eine Erfolgsfunktion definiert, die sich an den definierten Werbezielen, beispielsweise am maximalen „Return On Investment“ (ROI) der Kampagne, ausrichtet. Die KI korrigiert dann eigenständig den eingeschlagenen Weg der Budgetallokation, das heißt sie übernimmt die Aussteuerung und Optimierung der Werbekampagne – eine Aufgabe, die typischerweise zum Kompetenzbereich eines Mediaplaners gehört.
Selbst-Optimierung der Werbeausspielung
Der amerikanische Motorradproduzent Harley Davidson setzte beispielsweise eine KI auf sein „Media Asset Management“ an. Mit dem Ziel, Sales-Leads zu generieren, platzierte man automatisiert Anzeigen auf Google und Facebook, um Probefahrten zu bewerben. Ein KI-System wertete eigenständig aus den Interessensprofilen der Nutzer oder den verwendeten Suchbegriffen die Wahrscheinlichkeit einer „Conversion“ – also der Anmeldung für einen Probefahrttermin – aus. Zudem generierte es aus den damit erfolgreich angesprochenen Interessenten „Look-a-like“-Profile – gewissermaßen „Steckbriefe“ – mit denen weitere potenzielle Kunden gesucht werden sollten. Auch die Werbemittel selbst unterzog das System einem entsprechenden Optimierungsprozess. Neben den Faktoren Umfeld und Nutzerverhalten wurde auch die Kombination aus Anzeigentext und Anzeigengestaltung untersucht und stetig auf das Ziel der Leadgenerierung hin verbessert. Somit entstand ein lernendes System, welches eigenständig die Werbemittelgestaltung und -platzierung kontinuierlich optimierte.
KI in der Mediaplanung: Automatisierung und Skalierung
Inzwischen existieren aber auch Software-Plattformen, die diese Leistungen skaliert – „von der Stange“ – werbungtreibenden Unternehmen zur Verfügung stellen. Anzeigenplatzierungen lassen sich damit standardisiert über verschiedene Kanäle und Websites hinweg überwachen. Die Information über entsprechenden Bewegungen und Verhaltensweisen aktueller und potenzieller Kunden werden an zentraler Stelle zusammengeführt. Damit wird die Grundlage für ein optimiertes Mediamanagement geschaffen und eine ergebnisorientierte Distribution der Werbemittel gewährleistet.
Mithilfe von KI lassen sich enorme Datenmengen in kürzester Zeit verarbeiten. Profil- und Verhaltensdaten werden dabei innerhalb von Millisekunden mit Kontext- und Umgebungsdaten abgeglichen. Auch die Erfolgsmessung, die Kampagnenüberwachung und die Auswertung und Aufbereitung der Ergebnisse kann automatisiert über die Systeme erfolgen.
Datenzugang als Voraussetzung für den Rückgriff auf KI in der Mediaplanung
Voraussetzung dafür ist aber natürlich die entsprechende Datenbasis und der Zugang zu den Kunden-„Touchpoints“. Bei allen technischen Möglichkeiten verkörpert dies derzeit sicherlich das Nadelöhr bei der automatisierten Mediasteuerung durch KI. Auch hier können lernende Systeme zwar helfen, die blinden Flecken in der Customer Journey zu minimieren, die durch Datenschutzanforderungen oder technische Hürden zwischen einzelnen Mediengattungen und Kanälen entstehen. So lassen sich Lücken in der Surfhistorie oder in der demografischen Datenbasis auch hier durch Prognosen und Mustervervollständigungen schließen. Diese Fähigkeiten bleiben aber aktuell meist auf Akteure beschränkt, die ein umfassendes DSGVO-konformes Nutzer-Tracking gewährleisten können, also meist nur jene, die auf Basis von Registrierungen Verhaltensweisen an eine User-ID knüpfen können. In der Regel sind das jedoch nur die großen Plattformbetreiber wie etwa Google, Meta oder Amazon. Für Werbungtreibende stellt sich damit meist die Frage, ob sie bereit sind, für die Realisierung ihre Echtzeit-Mediastrategie Teil dieser Ökosysteme zu werden oder stattdessen auf Granularität und damit Präzision in der Kundenansprache zu verzichten.
Agents und die Rolle des Menschen
Perspektivisch dürfte die Entwicklung, hin zu noch mehr Automation, weiter an Fahrt aufnehmen. Bereits heute schon wird intensiv über sogenannte „Agents“ diskutiert, autonom agierende Einzelsysteme, die nicht nur die Werbeausspielung und Auswertung, sondern weitere, auch vorgelagerte Phasen des Mediaplanungsprozesses eigenständig abdecken und die einzelnen Schritte, abgestimmt auf die individuellen Bedürfnisse des Anwenders, miteinander verzahnen. Der menschliche Arbeitsaufwand ließe sich damit zweifelsohne noch weiter reduzieren.
Allerdings sollte bei aller Begeisterung für die Technologie und dem Wissen um deren Leistungsfähigkeit auch Augenmaß bei der zukünftigen Implementierung gewahrt bleiben: KI und maschinelles Lernen beruhen meistens auf der Berechnung von Wahrscheinlichkeiten, auf Mustererkennungen und der Ableitung von Prognosen. Es liegt dabei in der Natur der Sache, dass Außergewöhnliches, Lösungen, die nicht den erlernten Normen entsprechen, von den KI-Systemen oft nicht berücksichtigt oder erkannt werden. Genau das aber, aus der Masse und dem Erwartbaren herauszustechen, dürfte oft gerade im Marketing und in der Mediaplanung den entscheidenden Erfolgsfaktor verkörpern.
Wie bei allen Anwendungsfeldern von KI gilt somit auch hier: die besten Lösungen ergeben sich aus der durchdachten Kombination, nämlich dann, wenn die Effizienz der intelligenten Systeme auf menschliche Erfahrung und Intuition trifft: Die Daseinsberechtigung von KI besteht darin, unsere Arbeit zu unterstützen und besser zu machen. Das Heft des Handelns und die finale Entscheidungskompetenz sollten wir uns von ihr nicht aus der Hand nehmen lassen.
Der Text ist ein Auszug des Beitrages Künstliche Intelligenz (KI) im Marketing –
mit maschinellem Lernen den Kundendialog aus dem Band Die 10 wichtigsten Zukunftsthemen im Marketing, herausgegeben von Marcus Stumpf (Vahlen, 2025, ISBN 978-3-8006-7782-5)
Mehr zum Thema: Vortrag/Keynote von Prof. Dr. Andreas Wagener: „Von Cyborgs und Digitalen Lebewesen: Wie generative KI&VR menschliches Leben (und Sterben) verändern“:
Mehr Informationen zum Thema KI im Marketing finden Sie im Buch von Andreas Wagener Künstliche Intelligenz im Marketing, Haufe, Freiburg, 2023
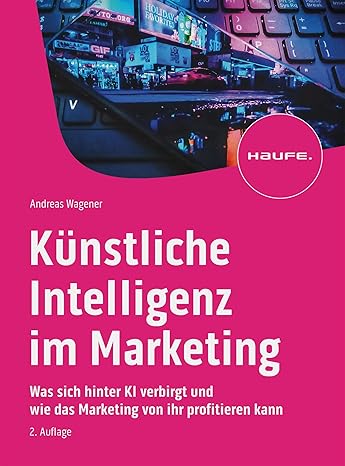
Mehr zu Themen wie Industrie 4.0, Big Data, Künstliche Intelligenz, Digital Commerce und Digitaler Ökonomie finden Sie auf unserer Newsseite auf XING sowie auf Facebook.
